
Nils Hille
Mittendrin statt nur dabei – dies war das Motto für die barrierefreie Gestaltung der Christuskirche in Mainz. Keinen Treppenlift am Rande des Aufgangs und auch keinen Fahrstuhl in einem Seiteneingang plante die Architektin des Projekts Ursula Fuss, die selbst im Rollstuhl sitzt. Sie entwarf stattdessen eine 66 Meter lange Rampe, die auf ihrem geschlängelten Weg zum Eingangsportal von dem Zwischenplateau der Treppe unterbrochen wird und sich erst auf dessen anderer Seite fortsetzt. „Als Rollstuhlfahrer müssen Sie diese Fläche überqueren. Und das ist genau der Platz, an dem die Leute vor und nach dem Gottesdienst stehen und schwätzen. Da ist Kommunikation programmiert“, erklärt Fuss ihr Konzept, das nach der Realisierung schnell funktionierte. Selbst der erst eher skeptische und nicht in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkte Landesbischof nutzt nun im Alltag diesen Weg, wie er Fuss nach der Fertigstellung erklärte – einfach, um auf dieser längeren Strecke ein paar Augenblicke Ruhe für sich zu finden. Ähnlich positive Rückmeldungen bekam Fuss auch auf ihren Umbau am Eingang eines Frankfurter Bürohauses.

Hier waren fünf Stufen zu überwinden. Nun führt eine Rampe von draußen durch den Eingangs-Ganzglaskubus hindurch und im Gebäude weiter. Damit sind 85 Zentimeter Höhendifferenz ausgeglichen. Zudem sorgte Fuss mit indirekter Beleuchtung und reflektierenden Materialien für einen helleren, optisch viel größer wirkenden Raum, der jetzt viel einladender wirkt.Dies sind zwei Beispiele dafür, dass es Alternativen zur Alu-Rampe vor dem Eingang geben kann. „Neben der Höhe und Breite gibt es immer auch die Länge, mit der ich arbeiten kann. Das sind viele Kollegen aber nicht gewohnt“, sagt Fuss.
Keine Aufmerksamkeit erregen
Erst dann, wenn ein Gebäude von allen Menschen genutzt wird und jeder sich spontan und ganz normal darin bewegen kann, spricht die Architektin von Barrierefreiheit: „Jeder soll gleichberechtigt ein Gebäude durch den Haupteingang besuchen können, sodass gar nicht im Mittelpunkt steht, ob er läuft, humpelt oder rollt.“
Die hessische Landesverordnung soll dies unterstützen. Sie sieht vor, dass ein Viertel aller neu gebauten Wohnungen barrierefrei zugänglich und nutzbar ist. Ein Fortschritt, könnte man im ersten Gedanken vermuten. „Doch hier wird schon falsch herum gedacht. Das bedeutet nämlich, dass Menschen mit Behinderung 75 Prozent der Räume nicht nur nicht bewohnen, sondern noch nicht einmal erreichen können. Eine Form der Ausgrenzung“, kommentiert Fuss.
In Wettbewerben komme das Thema dagegen allmählich an. „Zunächst gab es in Jurys oft Behindertenbeauftragte. Die hatten mehr eine Alibifunktion, denn ihnen fehlten oft die gestalterischen Kenntnisse. Die Barrierefreiheit wurde auch gar nicht in den Entwürfen gefordert.“ Nunmehr beobachtet Fuss, dass häufig auch zu diesem Thema Fachleute in den Preisgerichten sitzen. Auch sie selbst hat diese Aufgabe oft übernommen und mit ihren ständigen Einwänden direkt wie indirekt einiges erreicht. So sagte Kollege Gernot Schulz aus Köln zu ihr: „Ich habe Sie nun achtmal in Jurys erlebt und begriffen, worum es geht.“ Bei dem Wettbewerb zum Eingang der Burg Sooneck am Mittelrhein setzte er dies selbst um und gewann.
Er hatte ein neues vorgesetztes Gebäude vorgeschlagen, in dem ein Serpentinenweg über vier barrierefreie Rampen den Besucher aufwärts führt. Schon unterwegs hat er Ausblicke auf Burg und Landschaft. Danach wird das Weiterkommen allerdings schwierig. „Auch wenn ich die eigentliche Burg nicht barrierefrei erreichen kann, werde ich diesen Ort besonders erleben können“, erklärt Fuss ihre Begeisterung. Und sie macht damit deutlich, dass es ihr nicht um die kompromisslose Forderung geht, sich jederzeit überall barrierefrei bewegen zu können. Ihr geht es um das Bewusstsein der Architekten für das Thema: „Nicht bei jedem Neubau ist es notwendig, direkt einen teuren Aufzug einzubauen. Aber man sollte den Platz dafür vorsehen, sodass der Lift später problemlos nachgerüstet werden kann.“
Neubau-Hürden
Selbst wenn ein Lift vorhanden ist, ist dies keine Garantie für Barrierefreiheit. Das stellte Architekt Frank Opper aus Kaarst in dem vor einem Jahr fertiggestellten Einkaufszentrum „Düsseldorfer Arcaden“ fest. Auch Opper ist auf den Rollstuhl angewiesen. Bei einer Begehung zur Barrierefreiheit beobachtete er: „Die Schilder und deren Beschriftung sind viel zu klein, für Sehbehinderte erst recht. Die Leute drängeln sich davor, um sie lesen zu können. Und wenn sie mit dem Einkaufswagen zum Auto wollen, müssen sie immer die Aufzüge nehmen.“ Am Tag der Begehung waren aber alle außer Betrieb – eine Barriere selbst für Menschen ohne körperliche Einschränkungen.
Aus anderen Ländern hörte Opper da schon positivere Nachrichten: „Wenn Sie in Palma de Mallorca ein Ladenlokal neu eröffnen, muss dies barrierefrei zugänglich sein. Stellen Sie sich das mal in Deutschlands Altstädten vor“, meint Opper mit einem lachenden, aber auch fragenden Gesichtsausdruck. Hierzulande würde er sich oft auch eine freiere Auslegung der gesetzlichen Regelungen wünschen. Denn die Normen könnten auch einschränken: „Besser eine Rampe mit größerem Gefälle als gar keine. Doch die Angst vor Haftung ist viel zu groß.“
Bestehende Einfamilienhäuser barrierefrei umzurüsten, ist eine von Oppers Hauptaufgaben, die er mit seinem Vater im gemeinsamen Büro angeht. „Viele Anfragen kommen aus der Generation 50 plus. Diese Menschen bereiten sich und ihr Haus aufs Alter vor.“ Hauptsächlich die Badezimmer sollen dabei barrierefrei erneuert werden. Das hat auch die Industrie erkannt. Über einen persönlichen Kontakt wurde Opper zum Berater für eine Badezimmerserie von Villeroy und Boch. „Lifetime“ sollte alle Bedürfnisse der Barrierefreiheit berücksichtigen und auch von der Gestaltung her ansprechen. Hier kann man zum Beispiel den Waschtisch mit dem Rollstuhl unterfahren, was zusätzlich durch verdeckte Griffmulden erleichtert wird. Die seitlichen Ablageflächen dienen gleichzeitig als Armstützen. Und ein fahrbarer „Trolley“ ist multifunktional als Unterschrank, Ablagefläche, Stauraum, aber auch als Sitzbank nutzbar.
Für die Werbeaufnahmen der Badezimmerserie ließ Opper sich sogar mit den Produkten fotografieren. „Das hätten die anderen im Rollstuhl sofort gesehen, wenn die einfach irgendein Model dort platziert hätten, das normalerweise gar nicht darin sitzt.“

Lehre als barrierefreie Zone
In den Hochschulen ist dagegen das barrierefreie Bauen noch nicht angekommen. Seminare zu dem Thema werden mangels Teilnehmern wieder abgesagt. Auch die Anfrage an Ursula Fuss für einen Lehrauftrag an einer Universität erledigte sich schon vor Arbeitsbeginn wieder. Zu spät informierte die Hochschule ihre Studenten über das Angebot. „Hier war aber eigentlich schon der Ansatz falsch. Barrierefreies Planen ist nicht in einem Seminar abzuhandeln, sondern es muss in jeden Entwurf direkt miteingebunden werden.“ Das klappt bisher selten. Fuss hörte von Studenten, dass diese bei Entwürfen für ein Studentenwohnheim direkt am Anfang das Thema Barrierefreiheit berücksichtigen wollten.
„Das ist viel zu früh, sich damit schon zu beschäftigen“, bekamen sie von ihrem Dozenten als ablehnende Ansage zu hören.
Frank Opper kennt das Problem auch. Er gibt Seminare für Hochschulabsolventen in der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und stößt dabei auf ein großes Unwissen zu dem Thema. „In der Ausbildung haben sie so gut wie nichts davon gehört. Und bei der Arbeit in Büros waren Kenntnisse darin auf einmal nötig.“ Zwischen Lehre und Praxis klafft eine enorme Lücke. Und das, obwohl bei den privaten Bauherren das Thema längst präsent ist, wie Opper beobachtet: „Fast jeder hat in der Familie oder im Bekanntenkreis jemanden, der mit Einschränkungen oder einer Behinderung lebt. So ist das barrierefreie Bauen bei den 30- bis 40-Jährigen, die sich für das Eigenheim entscheiden, schon im Bewusstsein. Sie fragen direkt danach, wie sie es auch im Alter weiter nutzen können.“
In der Nähe von Oppers Büro in Kaarst stehen Teile eines Wohnneubaus leer, weil schon im Eingang zwei Stufen überwunden werden müssen, um in das Haus zu gelangen. Der Bauherr eines weiteren, im gleichen Zeitraum fertiggestellten Wohngebäudes wurde dagegen mit Anfragen überrannt. Er hatte altersgerechte Wohnungen planen lassen. „Auch wir bekommen regelmäßig Anrufe, ob wir nicht solche freistehenden Objekte kennen und vermitteln können.“

Schwellenabbau für den Tourismus
„Barrierefreiheit ist als Thema an vielen Stellen nicht angekommen“, sagen auch der Düsseldorfer Architekt André Burkhardt und die Hotelfachfrau Tanja Gröpper, die seit einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Sie haben gemeinsam das Büro „Ohne Barriere“ gegründet. Burkhardt scheut auch nicht vor der Kritik an seinem Berufsstand zurück: „Das Thema ist nicht in den Köpfen, leider auch bei vielen unserer Kollegen. Man muss sie mit der Nase draufstoßen, obwohl man Einrichtungen wie die ebenerdige Dusche in jeder Wohnzeitschrift ansehen kann. Viele wollen sich mit diesem ‚Tabu‘ nicht beschäftigen. Oder sie glauben, Barrierefreiheit könne nicht mit guter Gestaltung zusammengebracht werden.“
Im Tourismus zeigen sie, dass beides möglich ist: Burkhardt und Gröpper beraten deutsche Urlaubsregionen bei der Umstellung auf Zielgruppen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. „Vor allem der Schwarzwald ist so ein Gebiet, das unheimlich profitieren kann, wenn sich alle Menschen dort bewegen können. Dort ziehen wir auch mit Zollstock und Rollstuhl durch die Städte, testen und messen“, sagt Burkhardt. Und Gröpper ergänzt augenzwinkernd: „Wenn die Menschen sehen, dass ich mit dem Rollstuhl an einer Stelle nicht weiterkomme, dann haben sie auch keine Gegenargumente mehr.“
Die Hauptbeschäftigung des Düsseldorfer Duos liegt zurzeit vor allem bei dieser Beratung und Aufdeckung von Defiziten (siehe Seite 19). Burkhardt: „Richtige Planungsaufträge, bei denen wir in der Neugestaltung von Anfang an die Barrierefreiheit berücksichtigen können, bekommen wir leider nur selten. Und das, obwohl wir viele Gestaltungsideen haben und die spätere Nachrüstung immer teurer ist.“
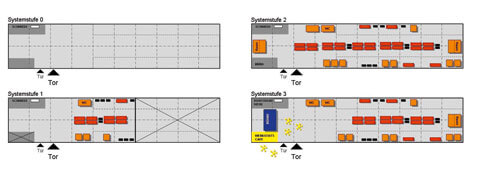
Neue Erreichbarkeit
Wilfried Klein geht kompromisslos ans Werk. Das muss er auch, denn bei ihm als stellvertretendem Leiter des Planungsamts der Stadt Dinslaken geht es um den öffentlichen Raum. „Immer wenn hier eine Straße umgebaut wird, werden die Übergänge barrierefrei gestaltet“, berichtet er. Seit über 40 Jahren sitzt Klein im Rollstuhl. Als er Architektur studierte, war die barrierefreie Erreichbarkeit von öffentlichen Gebäuden überhaupt kein Thema. „Ich musste mich in der Uni immer von Kommilitonen treppauf und treppab schleppen lassen“, erinnert er sich. Und so passt es nur zu gut, dass er sich heute dafür einsetzt, dass seine Stadt nach und nach barrierefrei wird.
Das ehemalige Zechengelände Lohberg, auf dem ein „komplett neuer Stadtteil“ entstehen soll, ist das neuste und größte Projekt in Dinslaken, bei dem von Anfang an eine Barrierefreiheit mitgeplant wird. So planten Studenten der RWTH Aachen eine Zwischennutzung der früheren Lohn- und Lichthalle der Zeche, die komplett barrierefrei nutzbar sein soll. Beim nahe gelegenen ehemaligen Ledigenheim hat das schon funktioniert. Hier haben sich neue Firmen angesiedelt, ein Veranstaltungssaal mit Bühne wird wieder genutzt und Menschen mit Behinderungen erreichen alle Räume. „Wir haben mit Rampen und Aufzügen dafür sorgen können“, erklärt Klein.
Auch auf private Investoren versucht er einzuwirken. „Hier haben wir natürlich wenig Handhabe, wie weit sie barrierefrei bauen.“ Trotzdem will er in einem Handbuch festlegen, welche barrierefreie Architektur die Stadt erwartet. Und mit der demografischen Entwicklung zu argumentieren, kann nicht schaden. „Das kenne ich ja von meiner Arbeit: Wenn ich dabei bin, halte ich mich auch nicht zurück. Ich muss schon selbst die Barrierefreiheit fordern. Andere Menschen zu berücksichtigen, ist aber eigentlich keine Sondersparte der Architektur, sondern sollte zum Denkprozess beim Entwurf immer dazugehören.“
Leserkommentare zu diesem Artikel: 1

