
Roland Stimpel
Bernd Müller bezeichnet sich als „letzten Ureinwohner Berlins“. Außer dem 76-Jährigen ist kein Lebender mehr bekannt, der in Berlins mittelalterlichen Keimzellen vor deren Zerstörung geboren und aufgewachsen ist – im Klosterviertel, Marienviertel, Nikolaiviertel oder Petriviertel. Diese Altstadt ist so radikal getilgt wie keine andere in Deutschland – aus dem Boden, aus dem Stadtplan und aus dem Bewusstsein der heutigen Bewohner. „Das kollektive Stadtgedächtnis fällt an einer entscheidenden Stelle aus“, sagt der Publizist Klaus Hartung.
Berlin ist überladen mit Zeugnissen der letzten 150 Jahre. Aber was zeigt die Stadt von den 600 Jahren davor? Die Herrschaftsgeschichte seit dem Barock ist noch an vielen Stellen lesbar, die Vergangenheit der gewöhnlichen Berliner kaum. Das fällt gerade jetzt auf: Klaus Hartung und andere suchen einen „bürgerschaftlichen Gegenpart zum Schloss“. Sie meinen nicht Fassaden von Patrizierhäusern, die es ohnehin kaum gab, sondern Stadtgrundrisse, kleinteilige Strukturen und auffindbare Orte, an denen anonyme und viele namhafte Berliner lebten. „Selbstfindung und Selbstaufklärung“ sind Hartungs Ziele. Beides hat längst begonnen, doch das Ganze ist ein Projekt für ein halbes Jahrhundert – zäh, streitgeladen und faszinierend.
Konsens der Zerstörung
Der wohl letzte Altstädter Bernd Müller gehört auch zu den ersten, die das Erbe wiedergewinnen. Dessen wenigen sichtbaren Reste präsentiert er in Mönchskutte mit Holzkreuz und Sandalen über den nackten Füßen, selbst im Januar. Als Fremdenführer, den auch viele Berliner brauchen, spaziert er vom Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtmauer an der Waisenstraße zur Ruine der Klosterkirche, über die Asphaltwüste des Molkenmarkts und durch die Plattenbaugassen des Nikolaiviertels, wo er 1932 geboren wurde.
Müller verklärt da nichts. In seinen Erinnerungen „Die Kinder vom Nikolaikirchplatz“ beschreibt er „enge, dunkle Höfe mit stinkenden Müllkästen, steile Treppen und kleine Stübchen, einfache Fenster und finstere Küchenlöcher, teils Gemeinschaftstoiletten auf dem Hof“. Er hat seinen Kiez aber auch als „Ort der Beschaulichkeit und Versunkenheit“ in Erinnerung. Ringsum toste längst die Millionenstadt. Straßen wurden seit der Jahrhundertwende verbreitert und durchgebrochen; Großbauten für Verwaltung und Handel hatten Teile der Altstadt überformt.
Die Nazis rissen dann ganze Blöcke ab; noch weit mehr Häuser wurden im Krieg zerbombt und zerschossen – auch das von Bernd Müller. Die Altstadt war aber keineswegs verschwunden. Nachdem die Trümmer abgeräumt waren, standen noch Dutzende von Bürgerhäusern und zumindest die Grundmauern von fünf Kirchen. Vor allem aber existierte das Straßennetz aus dem Mittelalter noch; östlich der Spree markierte es Ursprung und Organisation der alten Stadt.
Aber es herrschte in Ost wie West das, was Klaus Hartung als „Zerstörungskonsens der Nachkriegszeit“ bezeichnet. Für ihn gab es viele Gründe und Begründungen: stadthygienische, verkehrstechnische, leitbildliche (die durchgrünte Stadtlandschaft) und psychologische – die Hoffnung, mit Häusern verschwände auch unliebsame Vergangenheit. In den 60er-Jahren räumte die DDR auf. Wo 700 Jahre lang das zivile Zentrum Berlins gewesen war, etablierte sie eine sozialistische Staatsmitte, mit Repräsentationsachse vom Fernsehturm zum künftigen Palast der Republik und südlich davon einer hundert Meter breiten Verkehrsschneise. Zwischen beiden blieb das Rathaus übrig. Zuvor hatte der Bau von 1869 die Gegend dominiert und Bürgerstolz bezeugt, jetzt wurde er zum Dekorationsstück an der Staatsachse.
Doch kaum war Ostberlins moderne Mitte fertig, fielen ihre Mängel auf. Das Unwirtlichkeitsgefühl wuchs in den 70er Jahren auch auf dieser Seite der Mauer. Aber es gab ja nahe dem Rathaus noch das Nikolaiviertel – genauer, die Ruine der Nikolaikirche und fünf erhaltene Häuser. Als sich das 750-jährige Stadtjubiläum Berlins näherte, stellte die Staatsführung ein „Bedürfnis der sozialistischen Gesellschaft nach kulturgeschichtlicher und ästhetischer Bildung“ fest.
Ab 1979 wurde das Nikolaiviertel geplant – die erste Phase der Altstadt-Neuentdeckung und eine ziemlich spezielle: Plattenbau auf überwiegend mittelalterlichem Stadtgrundriss, mit Bautechnik der Moderne, Formspielen der Postmoderne und einigen Rekonstruktionen. Es sollte natürlich keine vorvorsozialistische Vergangenheit neu entstehen, sondern ein Schaustück für die DDR: Wir sind geschichtsbewusst und können auch historisierend-gemütlich. Und zwar mit unseren Mitteln.
Anklänge ans Alte wurden dezent gesucht. Chefarchitekt war Günter Stahn, der von manchen Kollegen nun geschnitten wurde, weil er gegen deren Utopiekomment verstieß. Dafür ging er aufs Volk zu.
Mich haben seine Bauleute damals auch mal gefragt“, sagt Bernd Müller stolz. Stahn konstruierte wie alle anderen im Land in Elementbauweise – nur eben mit vorgefertigten Betongiebeln nach Barockvorbild, montiert zu Blöcken statt Solitären. Er ließ die Nikolaikirche wiedererrichten, letzte bürgerliche Altbauten wie das Knoblauchhaus sanieren und einige abgerissene an neuen Standorten wieder aufbauen. Weitere Häuser entstanden nach historischen Fotos, teils auch aus Großplatten mit vorgeblendeten klassizistischen Fassaden.
Pünktlich zum Stadtjubiläum 1987 war das Ganze fertig. Es zeigt deutlich seine Ursprungszeit und seine Widersprüche: Es soll anheimelnd wirken und ist industriell gebaut. Es soll gewachsenen Stadtkern andeuten, ist aber eine isolierte und synchron geplante Insel zwischen Staatsachse und Schnellstraße. Es soll ein bisschen Individualität herzeigen, ist aber zentralstaatlich errichtet und bis heute in einer Hand, der einer städtischen Baugesellschaft. Alldessen ungeachtet wird in dem kleinstädtisch anmutenden Quartier gern gewohnt und spaziert. Der Stadthistoriker Florian Urban spricht von „einem der erfolgreichsten Projekte des DDR-Städtebaus – zumindest wenn man sich die Besuchermengen ansieht“.
Quartier statt Verkehrswüste
Auch manche Kritiker machen ihren Frieden mit dem Quartier. Nikolaus Bernau kritisierte vor Jahren dort „Fassaderitis“ und „Altstadtinszenierung“. Jetzt lobt er in seinem kleinen „Architekturführer Nikolaiviertel“ die „Rückbesinnung auf überlieferte städtebauliche Qualitäten“ und die Funktion des Gebiets als „Anker für kommunale Identität“. Das Ganze zeige, „dass man verloren geglaubte Viertel mit einer Kombination aus originalen Bauten, rekonstruierten Fassaden und städtebaulich angepassten Neubauten wieder zum Leben erwecken kann“.
Nach Mauerfall und Einheit geriet der alte Kern Berlins vorübergehend aus dem Fokus. Er rückte erst wieder mit dem „Planwerk Innenstadt“ hinein, das der damalige Baudirektor Hans Stimmann initiierte und der Senat 1999 verabschiedete. Straßengrundrisse und Blockgrenzen sollten rekonstruiert, überbreite Verkehrsschneisen eingeengt werden. Aber ausgerechnet am Molkenmarkt, dem Ursprungsort Berlins, rührte die Stadtregierung die Asphaltwüste „aus verkehrlichen Gründen“ nicht an. Auch auf der Spreeinsel im einstigen Petriviertel geschah und geschieht wenig. Hier lassen Straßen und Neubauten den geringsten Spielraum zur Anknüpfung an die Stadtgeschichte.

Am Stadtgründungsort Molkenmarkt ist aber in den letzten Jahren der Mut der Planer gewachsen: Die diagonal darüberführende Straße soll so verlegt und verengt werden, dass Platz für zwei Baublöcke entsteht. Das bettet das Rathaus wieder in die Stadt ein, befreit das Nikolaiviertel aus seiner Insellage und reaktiviert Berlins im 13. Jahrhundert begründetes Halbring- und Radialstraßennetz. Stadtgeschichtliche Preziosen können in neuer Gestalt wiederentstehen: das Gymnasium zum Grauen Kloster, mit seinen 435 Jahren eine der beständigsten Institutionen der Stadt, oder der Große Jüdenhof, ein Ensemble aus zwölf Häusern um einen fast geschlossenen Platz.
Obwohl Straßen und Leitungen verlegt werden müssen, könnte sich das Projekt schon allein fiskalisch rechnen: 27 000 Quadratmeter Grundstücksfläche werden auf vier Baufeldern gewonnen, fast alle heute in städtischem Eigentum. Noch viel größer ist der indirekte Gewinn: Stadtteile werden zusammengeflickt, Bewohner und Investoren gewonnen und gebunden, die lokale Identität wird gestärkt und der Tourismus belebt. Der Blick nach vorn und der Blick weit zurück ergänzen einander. Berlin gewinnt ein dichtes, zentrales, kleinteilig-gemischtes und dadurch nachhaltiges Quartier – und einen wichtigen Teil seines urbanen Gedächtnisses.

Rekonstruiert wird aber nur städtebaulich: der Verlauf von Straßen und Gassen, im Gröbsten die Nutzungen und die Höhe der Häuser. Bauherren soll es weitgehend freistehen, an Gestaltungstraditionen des 15. oder des 20. Jahrhunderts anzuknüpfen – oder an gar keine. Ein Senatspapier schreibt von der „Konzeption, auf der Grundlage der historischen Strukturen ein funktionierendes neues Quartier zu entwickeln“.
So reizvoll das Projekt städtebaulich und so unumstritten es im Großen ist, so langsam kommt es voran. 13 Jahre nach dem ersten Anstoß hofft der Senat, demnächst den Bebauungsplan aufzustellen. Da gibt es aber noch Unsicherheit. Berlins Koalitionspartner SPD und Linkspartei streiten über einen Platz. Und es gibt Widerstand wegen der Straßenverlegung. Für die Industrie- und Handelskammer sagt Verkehrssprecher Matthias Klussmann einen Satz, der wie von anno 1958 klingt, aber von 2008 ist: „Der heutigen Stadt mit ihren Mobilitätsanforderungen wird man nicht mit historischen Straßengrundrissen gerecht.“ Der Senat setzt hingegen darauf, dass von den heute 70 000 Autofahrern, die pro Tag in der Exaltstadt Gas geben, rund 20 000 andere Wege oder andere Verkehrsmittel nehmen. In der Nähe wird noch eine U-Bahn gebaut.
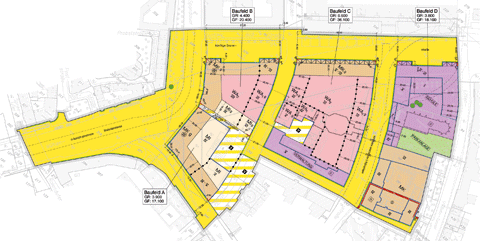
An Politik, Klagen und Finanzkrise kann das Projekt Molkenmarkt immer noch scheitern. Wenn es aber auf den Weg kommt, dann bringt das auch Schub für das dritte Quartier der einstigen Berliner Altstadt, gelegen zwischen dem alt-neuen Schloss und dem Fernsehturm. Wie heißt das Gebiet? Jeder sucht seine eigene Bezeichnung, etwa Teilnehmer des Schlosswettbewerbs am anderen Flussufer: „Raum um das Rote Rathaus und das Marx-Engels-Denkmal“ boten die einen, das „völlig zerstörte Alt-Berlin“ ein Zweiter und ein „modernes Zentrum ostdeutscher Prägung“ ein Dritter. Manche Berliner nennen alles Marx-Engels-Forum, andere reden vom Park vor dem Rathaus.
Wieder andere nennen es Alexanderplatz, obwohl dieser einen Dreiviertelkilometer weg vom Fluss liegt, jenseits von Fernsehturm und Bahnhof. Das ist so, als hätte München eine Brache vom Viktualienmarkt bis zur Isar, die aus Verlegenheit „Marienplatz“ genannt wird. Ein in Berlin lebender Amerikaner gab die treffendste Definition für den diffusen Raum: „Well – das ist keine richtige Gegend.“
So viele willkürliche Bezeichnungen und kein verbindlicher Name – das steht für ein einzigartiges Phänomen: Im Kern einer 3,4-Millionen-Stadt hat ein zentrales, 700 Jahre bebaut gewesenes Gebiet jede Identität verloren, ist kein Quartier mehr, sondern anonymer Leerraum. Aus einem Zentrum der deutschen Aufklärung, wo Moses Mendels-sohn philosophierte und Lessing Dramen schrieb, wurde ein Treffpunkt jugendlicher Berliner Komatrinker, die hier manchmal zu Hunderten soffen, pöbelten und sich erbrachen. Seit Januar gilt darum ein amtliches Zechverbot, ausgesprochen für die „Grünanlagen im Bereich Fernsehturmareal“.
Damit verschwinden hoffentlich auch die Urinlachen an der Marienkirche von 1230. Sie war im vergangenen Winter Schauplatz einer Vortragsreihe des Vereins Berliner Historische Mitte mit dem Titel „Unter dem Pflaster liegt die Stadt“, die natürlich auch Bernd Müller besuchte. Hier trug die Gegend einen schlichten, alt-neuen Namen: Marienviertel. Referate und Diskussionen kreisten um die Frage: Kann aus dem städtischen Vakuum wieder ein Quartier werden?
Seit der Palast der Republik weg ist, dehnt sich das Nichts mitten in der Stadt 800 Meter weit. Recht verloren steht ein wenig Zierrat darin herum: Reinhold Begas’ Neptunbrunnen, der vom einstigen Schlossplatz herverpflanzt ist, und ein Marx-Engels-Denkmal aus der Gorbatschow-Epoche, nur noch schüchterne vier Meter hoch. Wenn das Schloss den Westteil des Leerraums füllt, was wird dann mit dem Riesenloch östlich der Spree? Hans Stimmann fragt rhetorisch: „Soll man von Stellas Belvedere aus nichts anderes sehen als die Rücken von Marx und Engels?“
Und Klaus Hartung erinnert an „Piranesis Blick auf die Kuhweide, unter der sich das Forum Romanum verbarg“. Wird das Quartier neu bebaut, ergibt sich fast von allein wieder der alte Stadtgrundriss: Viele Grundstücke sind nicht enteignet und die Rückübertragungsansprüche der Alteigentümer und ihrer Erben leben wieder auf, sobald die Grünfläche zum Bauland wird. Verhandlungsgrundlage sind dann die alten Parzellen.
Das Projekt kann in den nächsten Jahren noch nicht starten; der Raum wird zunächst U-Bahn-Baugrube. Bernd Müller, der längst als Rentner am Stadtrand lebt, rechnet für sein Leben nicht mehr damit. Zumal es Widerstand gegen die Idee gibt – teils weil viele Bürger sich hier derzeit nichts anderes vorstellen können als die gewohnte grüne Leere, teils wegen der Staatsachse, an der das Herz einiger Nachkriegstraditionalisten hängt. Aber wenn es im Stadtraum um Erinnerungswert geht, dann bringt auf Dauer die Leere als Symbol der halben DDR-Zeit weniger Gewicht auf die Waage als die 700 Jahre zuvor.
Zudem könnte das Marx-Engels-Denkmal stehen bleiben. „Die beiden würden dann wieder aus der Staatsachse in die Mitte der Gesellschaft rücken“, meint Hans Stimmann augenzwinkernd. Nur ihre Adresse wäre leicht jenseitig: Heiligegeiststraße 16.

